
Institut für Erziehungswissenschaft mit Schwerpunkt in außerschulischen Feldern
Kritische – gesellschaftsbezogene – Reflexionen, die Überschreitung disziplinärer Grenzen und methodologische Vielfalt stellen die Eckpfeiler des wissenschaftlichen Arbeitens innerhalb unseres Instituts dar. Der besondere Fokus gilt der Wahrnehmung und Auseinandersetzung mit institutionellen Normalisierungsstrategien und Schließungsmechanismen wie auch der individuellen und institutionellen Öffnung für neue Perspektiven.
Unser Institut ist an den Profilfeldern "Bildungsprozesse in der digitalen Welt" und "Bildung in der demokratischen Gesellschaft" beteiligt.
Im Institut behandeln wir Fragen der Allgemeinen Erziehungswissenschaft und von Bildungsprozessen in diversen Feldern. Forschungs- und Lehrgebiete werden durch die am Institut angesiedelten Professuren – die Professur Interkulturelle Pädagogik und Bildungsgerechtigkeit (Prof. Dr. Mechtild Gomolla) und die Professur für Allgemeine Erziehungswissenschaft mit Schwerpunkt Gesundheitsbildung (Prof. Dr. Annette Miriam Stroß) – geprägt.
Vorlesungsreihen
Professur Allgemeine Erziehungswissenschaft und Gesundheitsbildung
Die Professur beschäftigt sich mit Fragen
- der Bildung, Erziehung und Sozialisation einschließlich aktuellen Fragen der Bildungspolitik und Qualitätssicherung,
- der erziehungswissenschaftlichen Wissenschaftsforschung und Historiographie,
- der pädagogischen und medizinischen Wissenschafts-und Professionsgeschichte sowie
- aktuellen Fragen der Gesundheitserziehung und Gesundheitsbildung einschließlich angrenzender Paradigmen (Gesundheitsförderung, Gesundheitskommunikation, Gesundheitsmarketing u. a.).
In aktuellen Forschungs- und Praxisprojekten werden darüber hinaus Möglichkeiten der reflexiven wie auch wahrnehmungssensiblen Erweiterung eines allzu eng geführten inhaltlich-methodischen Verständnisses innerhalb der Erziehungswissenschaft und der Bildungsforschung (zum Beispiel hinsichtlich der poetologisch-ästhetischen Entgrenzung eines instrumentellen Verständnisses von "Gesundheit") ausgelotet.
Nähere Informationen erhalten Sie in der Forschungsdatenbank unserer Hochschule sowie auf der Website "Bildung, Mythen und Gesundheit" von Prof. Dr. Anette Stroß.
Sprechstunden (während der Vorlesungszeit: dienstags 16-17 Uhr, nach vorheriger Anmeldung; in der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung)
Professur Interkulturelle Pädagogik und Bildungsgerechtigkeit
An der Professur bearbeiten Prof. Dr. Mechtild Gomolla und ihr Team – Noomi Arndt, Paulina Miliczek, Paula Höh und Nirascha Dusik – Fragen von Erziehung und Bildung in der Migrationsgesellschaft. Schwerpunkte bilden:
- Bildung im Kontext von Globalisierung, (Flucht-)Migration und Pluralisierung,
- Bildungsungleichheit in der Migrationsgesellschaft,
- Diskriminierung, Rassismus und Rechtsextremismus in Gesellschaft und staatlichen (Bildungs-)Institutionen – auch unter den Nachwirkungen der NS- und Kolonialgeschichte,
- Bildungspolitik, Bildungsreform und Bildungssteuerung sowie
- Theorien und Konzepte für eine diskriminierungskritische Bildungspraxis, Professionalisierung und Institutionenentwicklung.
Wir bieten Lehrveranstaltungen für Lehramtsstudierende und für den Masterstudiengang Interkulturelle Bildung, Migration und Mehrsprachigkeit an.
Mittwochs, 15.00 - 16.00 Uhr (in Präsenz, via Webex oder telefonisch); bitte melden Sie sich über Stud.IP mit einem kurzen Hinweis zum Gesprächsanlass an.
Woran wir forschen
- "Decolonize Education. Eine sozialwissenschaftliche Analyse des Umgangs mit der Kolonialgeschichte im Klassenzimmer der Migrationsgesellschaft" lautet das Promotionsprojekt von Noomi Arndt.
- Das Buchprojekt von Prof. Dr. Mechtild Gomolla hat das Thema "Schulreform, Neue Steuerung und Migration" (Beltz Juventa Verlag).
- "Subjektivierungsprozesse, Jugend(sozial)arbeit und politische Bildung" ist das Promotionsprojekt von Paulina Miliczek.
- Das Promotionsprojekt von Agnesa Hasanaj heißt: „Wie Heranwachsende Rassismus gegenüber ihren Eltern erleben. Intergenerationale Auswirkungen und Verarbeitungsmuster von sekundären Rassismuserfahrungen.“
- "Gesundheits- und Krankheitsmythen auf der Spur. Ein innovativer Ansatz für die Aus- und Weiterbildung in Gesundheitsberufen“ (Beltz Verlag) ist das aktuelle Buchprojekt von Prof. Dr. Annette Miriam Stroß.
- Zum Thema "Neo-Ontologische Perspektiven auf Bildung“ promoviert Andreas Stock.
- Das Habilitationsprojekt von Martina Möller hat das Thema "Reflexive Freizeitpädagogik. Eine systematische Annäherung unter erziehungswissenschaftlicher Perspektive mit besonderem Fokus auf die Freizeitbildung".
Publikationen
Allgemeine Erziehungswissenschaft und Gesundheitsbildung:
- Carlsburg, B. v. / Stroß, A.M. (Hrsg. / eds.) (2021): (Un)pädagogische Visionen für das 21. Jahrhundert. (Non-)Educational Visions for the 21st Century. Reihe: Baltische Studien zur Erziehungs- und Sozialwissenschaft, Bd. 37, Frankfurt a.M.: Peter Lang.
- Stroß, A.M.: Gesundheitsbildung als politische Vision: Ein ‚anderer‘ Zugang zur RAVA-Strategie. In: Carlsburg, B. v. / Stroß, A.M. (Hrsg. / eds.): (Un)pädagogische Visionen für das 21. Jahrhundert. (Non-)Educational Visions for the 21st Century. Reihe: Baltische Studien zur Erziehungs- und Sozialwissenschaft, Bd. 37, Frankfurt a.M.: Peter Lang 2021, S. 453-474.
- Stroß, A.M.: „Als das kleine Virus tanzte …“. Ein bildungswissenschaftlicher Essay. In: Paragrana. Internationale Zeitschrift für Historische Anthropologie, Bd. 30, Heft 2, 2021, S. 106-120.
- Stroß, A.M.: Curriculare Grundlagen für eine „Gesundheitspädagogik und -didaktik“. Ein neues Studienfach für angehende Grundschullehrerinnen und -lehrer? In: Goldfriedrich, M. / Hurrelmann, K. (Hrsg.): Gesundheitsdidaktik, Weinheim: Beltz 2021, S. 65-84.
- Goldfriedrich, M./Hoffmann, S./Müller Y./Schmid, A. C./Spallek, J./Stroß, A.M./Tallarek, M. (2022): Konzeptpapier für einen Modellstudiengang „Gesundheitspädagogik und Gesundheitsdidaktik“. https://doi.org/10.22032/dbt.52342.
- Nauerth, T. / Stroß, A.M. (Hrsg.) (2022): In den Spiegel schauen. Friedenswissenschaftliche Perspektiven für das 21. Jahrhundert. Norderstedt: BoD.
- Stroß, A.M. (2022): Initiating educational processes, sensitizing perceptiveness, strengthening political agency. Health education in German schools.德国学校的健康教育 —基于《联合国 年可持续发展议程》的愿景.安妮特·斯特罗斯 著;刘成 译. In: China Journal of Peace Studies, Nanjing (1), S. 167-192.
- Stroß, A.M. (2023): Health education. In: Handbook of the Anthropocene: Humans between Heritage and Future, ed. by N. Wallenhorst & C. Wulf, Singapore: Springer Nature, S. 1365-1370.
- Stroß, A.M (2024): Gesundheit. In: Dederich, M./Zirfas, J. (Hrsg.): Optimierung. Ein interdisziplinäres Handbuch. Wiesbaden: Springer VS, S. 45-50.
- Stroß, A.M. (Hrsg. / ed.) (2025): Wissenschaft aus Leidenschaft. Persönliche, biografische und wissenschaftliche Aspekte. Personal, biographical and scientific aspects. Aspekty osobiste, biograficzne i naukowe. Münster: Lit. (zus. m. Spiegel, E./Lehner-Hartmann, A./Mariański, J.)
- Stroß, A.M.: Können Bildungsprozesse (in) der Wissenschaft förderlich sein? Einblicke in die Forschungswerkstatt. In: Wissenschaft aus Leidenschaft. Persönliche, biografische und wissenschaftliche Aspekte, hrsg. v. E. Spiegel, A.M. Stroß, A. Lehner-Hartmann u. J. Mariański Münster: Lit 2025, S. 139-152.
- Stroß, A.M.: „Gesundheit“ als Denk- und Handlungskategorie am Ende des Anthropozäns: Über Normen, Mythen und ein neues Bildungsverständnis. In: Wissenschaft aus Leidenschaft. Persönliche, biografische und wissenschaftliche Aspekte, hrsg. v. E. Spiegel, A.M. Stroß, A. Lehner-Hartmann u. J. Mariański Münster: Lit 2025, S. 411-437.
Interkulturelle Pädagogik und Bildungsgerechtigkeit:
- Arndt, Noomi (2021): Ein Gespräch zwischen Noomi Arndt, Susanne Belz und Anna Feldbein über die Arbeit als Antirassismustrainerin. In: Bürger & Staat. Rassismus - Geschichte, Spuren, Kontinuitäten. Heft 1-2/2021, S. 58-66.
- Arndt, Noomi (2024): Schule.Macht.Rassismuskritik. In: SchlaU Werkstatt für Migrationspädagogik. Onlinekurs für Fach- und Lehrkräfte zur Rassismuskritik in der Institution Schule.
- Çelik, Ç./Gomolla, M./Kantzara, V./Kollender, E./Loos, M (2023).: Demarcating new borders: Transnational Migration and New Educational Governance. Empirical Explorations in Greece, Turkey and Germany. In: Heinemann, A./Karakaşoğlu, Y./Linnemann, T./Rose, N./Sturm, T. (Hrsg.): Ent|grenz|ungen. Beiträge zum 28. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft (DGfE). Opladen: Verlag Barbara Budrich, S. 65-75.
- Gomolla, M./ Kollender, E. (2022): Reconfiguring the relationship between immigrant parent and schools in the post-welfare society. The case of Germany. In: British Journal of Sociology of Education 43 (5), S. 718-736. https://doi.org/10.1080/01425692.2022.2058463 (Peer Review).
- Gomolla, M. (2022): School reform, educational governance and discourses on social justice and democratic education in germany. In: Pink, W.T (Editor in Chief): Oxford Encyclopedia of School Reform. Oxford: Oxford University Press, S. 705-723. (Online verfügbar als Teil der Oxford Research Encyclopedia of Education: https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190264093.013.1455 ) (Peer Review)
- Gomolla, M. (2023). Direkte und indirekte, institutionelle und strukturelle Diskriminierung. In: Scherr, A./El-Mafaalani, A./Reinhardt, A.C. (Hrsg.): Handbuch Diskriminierung. Springer Reference Sozialwissenschaften. 2. Auflage. Wiesbaden: Springer VS, S. 171-194. https://doi.org/10.1007/978-3-658-11119-9_9-2
- Gomolla, M. (2024): Migration und Schule – Restrukturierungen des Diskurses im Kontext datenbasierter Schulentwicklung im Spiegel einer Dokumentenanalyse. In: Bildung und Erziehung 77 (1), S. 7-25. (Peer Review)
Personen
Institutsleitung
Sprechstunden (während der Vorlesungszeit: dienstags 16-17 Uhr, nach vorheriger Anmeldung; in der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung)
Mittwochs, 15.00 - 16.00 Uhr (in Präsenz, via Webex oder telefonisch); bitte melden Sie sich über Stud.IP mit einem kurzen Hinweis zum Gesprächsanlass an.
Sekretariat
Akademische Mitarbeitende
Sprechzeiten: Nach Vereinbarung
Interkulturelle Bildung, Migration und Mehrsprachigkeit (IMM)
Sprechstunde: Mo 8.9., Mi 17.9., Mi 1.10. jeweils 11-12 Uhr über Webex
Anmeldung im Stud.IP.
Sprechstunde nach Absprache
(Kontaktdaten folgen)
Habilitand:innen und Doktorand:innen
Sprechzeiten: Nach Vereinbarung
Sprechstunde nach Absprache
Kontaktdaten folgen







 Prof. Dr. phil. habil. Annette Stroß, M.A.
Prof. Dr. phil. habil. Annette Stroß, M.A.
 Prof. Dr. phil. Mechtild Gomolla
Prof. Dr. phil. Mechtild Gomolla
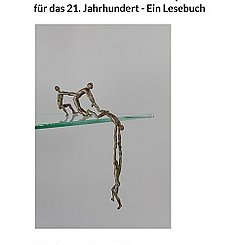

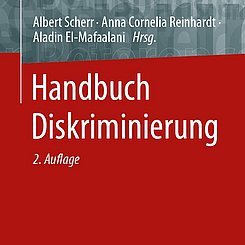

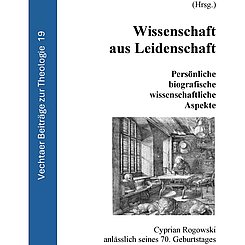
 Noomi Arndt, M.A.
Noomi Arndt, M.A.
 Katja Dolinar Hansmann, M.A.
Katja Dolinar Hansmann, M.A.
 Paulina Miliczek, M.A.
Paulina Miliczek, M.A.
 Andreas Stock, M. A.
Andreas Stock, M. A.
 Dr. phil. Yafang Wang
Dr. phil. Yafang Wang
