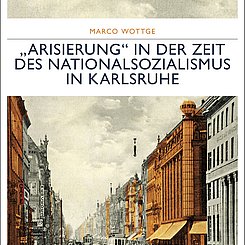Stadtgeschichte: Erste umfassende Aufarbeitung der „Arisierung“ in Karlsruhe
Die erste umfassende Aufarbeitung der Verdrängung Karlsruher Jüdinnen und Juden aus dem Wirtschafts- und Erwerbsleben während des Nationalsozialismus legt Dr. Marco Wottge mit seiner kürzlich als Buch erschienenen Dissertation vor. Ermöglicht wurde seine Forschungsarbeit durch ein von der Stadt Karlsruhe gestiftetes Promotionsstipendium. Doktormutter ist Prof. Sabine Liebig, Historikerin an der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe.

Buchvorstellung im Stadtarchiv Karlsruhe mit v.l. Prof. Dr. Sabine Liebig (Historikerin an der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe), Dr. Marco Wottge (Autor), Dr. Albert Käuflein (Kultur-Bürgermeister) und Dr. Katrin Dort (Stadtarchiv-Leiterin). Foto: David Manherz / Pädagogische Hochschule Karlsruhe
Die systematische wirtschaftliche Ausgrenzung jüdischer Karlsruherinnen und Karlsruher begann am 16. März 1933 mit einem Antrag des nationalsozialistischen Stadtrats Adolf Friedrich Jäger. Er forderte, dass die Stadt die jüdische Großmetzgerei Gebrüder Hagenauer nicht mit der Lieferung von Fleisch für das Städtische Klinikum beauftragen sollte – obwohl diese Metzgerei das mit Abstand günstigste Angebot abgegeben hatte. Nur zwei Wochen später setzte die NSDAP dann ohne Gegenstimmen durch, dass „sämtliche städtische Stellen“ nicht mehr in jüdischen Geschäften einkaufen oder Lieferverträge mit jüdischen Firmen abschließen durften.
Mindestens 400 Grundstücke, über 1.000 Firmen sowie unzählige Wertgegenstände gingen zwischen 1933 bis 1945 in Karlsruhe zwangsweise in „arische“ Hände über. Wie und in welchem Ausmaß jüdische Unternehmen während des Nationalsozialismus verdrängt und die Existenz jüdischer Bürgerinnen und Bürger vernichtet wurde, zeigt Dr. Marco Wottge in seiner jüngst als Buch erschienenen Forschungsarbeit „'Arisierung' in der Zeit des Nationalsozialismus in Karlsruhe“. Die im Rahmen eines von der Stadt Karlsruhe gestifteten Promotionsstipendiums entstandene Arbeit wurde von der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe als Dissertation angenommen und ist nun in der vom Stadtarchiv Karlsruhe herausgegebenen Schriftenreihe „Forschungen und Quellen zur Stadtgeschichte“ veröffentlicht worden. Vorgestellt wurde die Publikation vergangene Woche im Stadtarchiv bei einem Pressegespräch mit Dr. Albert Käuflein. Der ehemalige Stadtrat und jetzige Kultur-Bürgermeister hatte das Stipendium anlässlich des 300. Stadtgeburtstags vorgeschlagen.
Wie die finanzielle Ausplünderung ablief
„Mit seiner umfassenden Aufarbeitung der ‚Arisierung‘ hat Dr. Wottge eine Forschungslücke in der Karlsruher Regionalgeschichte geschlossen“, unterstreicht Doktormutter Prof. Dr. Sabine Liebig. Die Arbeit verbinde Mikro- und Makrogeschichte und ermögliche eine eindrückliche Gesamtschau, so die Professorin für Neuere und Neueste Geschichte und ihre Didaktik an der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe. Anhand eines Stadtplans zeigt Dr. Wottge beispielsweise, welche Grundstücke wann „arisiert“ wurden, und listet für 1933 insgesamt 533 jüdische Unternehmen mit Karlsruher Geschäftsadresse auf. Außerdem schildert der Wissenschaftler in seiner rund 400 Seiten starken Publikation, wie betroffene jüdische Bürgerinnen und Bürger versucht haben, sich gegen Verdrängung, Enteignung und Raub zu wehren.
„Die Frage, wie die finanzielle Ausplünderung in Karlsruhe genau abgelaufen ist, haben wir uns schon länger gestellt“, erläutert Jürgen Schuhladen-Krämer vom Stadtarchiv Karlsruhe. Marco Wottge habe sie nun sehr differenziert beantwortet und deutlich gemacht, dass vor allem NSDAP und Stadtverwaltung, aber auch die Bevölkerung von der „Arisierung“ profitiert hätten. „Karlsruhe gehörte nicht nur zu den ersten Städten, welche eine umfassende Diskriminierung der jüdischen Bevölkerung betrieb, sondern eilte mit den antisemitischen Beschlüssen insbesondere entsprechenden Reichsgesetzen voraus und deklassierte Juden zu Bürgerinnen und Bürgern zweiter Klasse“, schreibt Wottge. Mit seiner Studie will er den Blick dafür schärfen, wie brüchig zivilisatorische Errungenschaften sein können. Die Frage, warum sich die nicht-nationalsozialistischen Mitglieder des Karlsruher Stadtrats ab 1933 so bereitwillig der NS-Politik fügten, bleibt auch nach fast 90 Jahren höchst aktuell. Zurecht gilt die Aufarbeitung des Nationalsozialismus als „grundlegende Bedingung unserer heutigen demokratischen Kultur“, wie es im Geleitwort der Arbeit heißt.