Förderlinie DATIpilot: Antrag für Format Innovationssprints mit Vorlage und Anleitung
DATIpilot ist ein Experimentierraum für eine effektive Transferförderung und versucht mit innovativen Förderformaten neue Akteure, insbesondere aus dem Bereich der Sozialen Innovationen, zu einer Teilnahme zu motivieren. Interessant für kleine Transferprojekte sind die Innovationssprints. Die unkompliziert gehaltene Antragsstellung im ersten Schritt wird hier beschrieben. Frist zur Einreichung einer Kurzskizze ist der 31. August 2023.
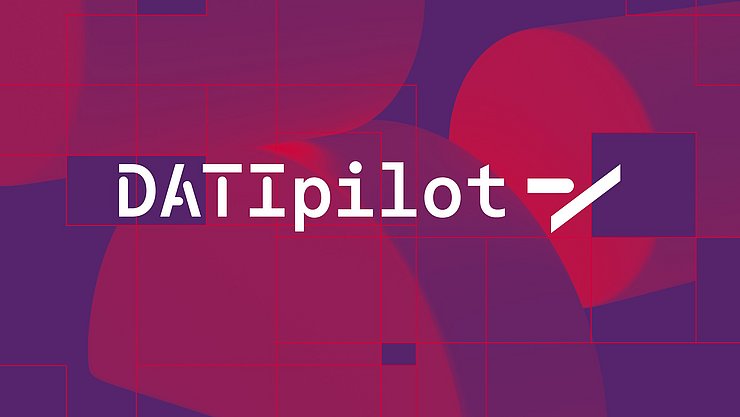
Es ist die erste Förderrichtlinie für DATIpilot erschienen. DATIpilot ist ein Experimentierraum für eine effektive Transferförderung. Die Erfahrungen sollen am Ende in die Transferagentur DATI eingehen. Die DATI wird eine eigenständige Agentur sein, die ihre Förderziele und -strukturen im gegebenen Rahmen wird selbst gestalten können.
DATIpilot bewegt sich zwar in den etablierten Strukturen der Projektförderung, versucht aber mit seinen zwei neuen Förderformaten, den Innovationssprints und den Innovationscommunities, bereits Neues. Interessant für kleine Transferprojekte sind die Innovationssprints. Hier werden Projekte gesucht, die ungewöhnliche Herangehensweisen, Perspektiven oder Partnerschaften für Transfer und Ko-Kreation erproben wollen. Niedrigschwellige und flexible Förderung und neue Auswahlerfahren sollen neue Akteure, insbesondere aus dem Bereich der Sozialen Innovationen, zur Teilnahme motivieren.
Antragstellung Innovationssprints
Mit den Innovationsprints können kleine Projekte über einen Zeitraum von drei bis maximal 18 Monaten mit bis zu 150.000 Euro pro Partner gefördert werden. Zwei Optionen sind möglich:
- Sie bewerben sich mit einem Einzelvorhaben.
- Sie bewerben sich mit einem Praxispartner (Unternehmen, Kommune, Verein o.a.) für ein Tandemvorhaben, in dem beide Partnereinrichtungen gefördert werden.
Der erste Schritt ist die Einreichung einer Kurzskizze bis spätestens 31. August 2023. Diese muss verbindlich auf einer bereitgestellten Vorlage angefertigt werden.
Das Template sowie eine Anleitung zur Einreichung der Kurzskizze in easy-Online und weitere Informationen werden unter folgendem Link zur Verfügung gestellt: https://www.bmbf.de/bmbf/de/forschung/datipilot/datipilot_node.html – hier findet sich auch die ausführliche Förderrichtlinie. Hier geht es direkt zum (nicht barrierefreien) PDF des Skizzentemplates und der Schritt-für-Schritt-Anleitung für easy-Online.
Die Kurzskizze besteht aus 6000 Zeichen, die sich folgendermaßen verteilen:
- Was ist der innovative Kerngedanke Ihres Projekts? (500 Zeichen)
- Was ist Ihr Lösungsansatz? Welche Ziele verfolgen Sie mit dem Projekt? Was ist ihr Ausgangspunkt? Auf welchen Erkenntnissen/Erfahrungen bauen Sie auf? Vor welchem Transfer- oder Innovationsproblem stehen Sie? (3000 Zeichen)
- Welche konkreten Schritte wollen Sie im Projekt umsetzen? Welche Anwendergruppen (beispielsweise Unternehmen/Kommunen/Vereine) könnten kurz- und langfristig von Ihrem Projekt profitieren? Welches Innovationspotenzial schaffen Sie für diese? (2000 Zeichen)
- Warum sollte gerade Ihr Projekt gefördert werden? Was ist das Neue an Ihrem Projekt? (500 Zeichen)
Außerdem sind noch die Kontaktdaten der Projektpartner, Angabe zur Art der Innovation und das Themenfeld (mit Vorauswahlliste im Template), zur Laufzeit und die geplante Fördersumme zu machen. Bei Verbundprojekten ist eine gemeinsame Kurzskizze durch die Verbundkoordination vorzulegen.
Die ausgefüllte Vorlage wird im Portal „easy-Online“ hochgeladen. Alle Kurzskizzen werden vom BMBF und dem Projektträger nach den folgenden Kriterien geprüft und selektiert:
- Originalität und Neuheitsgrad der Projektidee,
- gesellschaftliche Relevanz des Themas bzw. gesellschaftliche Bedeutung des geschaffenen Innovationspotenzials im Erfolgsfall,
- Umsetzbarkeit in der gegebenen Zeit bzw. Eignung der Förderung, einen signifikanten Fortschritt für das adressierte Problem zu erzielen.
Wer bei dieser Vorauswahl erfolgreich war, wird in der zweiten Stufe zu einer der über die Republik verteilten so genannten „PopUp-Veranstaltung“ eingeladen, bei denen jedes Projekt sich in einem ca. 5-minütigen „Pitch“ präsentiert. Laut Informationsveranstaltung des BMBF wird es etwa 10 solcher Veranstaltungen geben mit jeweils 40 Teilnehmenden, voraussichtlich im November 2023. Die überzeugendsten Projektideen werden bei den Pitches tatsächlich von den Teilnehmenden selbst ausgewählt. Auf diese Weise nicht ausgewählte Projekte haben noch die Chance, ausgelost zu werden. Das Auswahlergebnis wird direkt auf der Veranstaltung und im Anschluss schriftlich mitgeteilt.
In einer dritten Stufe müssen dann doch förmliche Förderanträge nach dem üblichen Verfahren eingereicht werden. Diese werden dann u.a. in Bezug auf Kongruenz mit den ursprünglich vorgelegten Kurzskizzen überprüft und erst dann wird (endgültig) über die Förderung entschieden.
Kirsten Buttgereit, Referentin für Transfer, und Stefan Wörmann aus dem Forschungsreferat stehen Ihnen gerne unterstützend zur Verfügung. Wenn Sie Interesse an einer Antragstellung haben, melden Sie sich bitte bis Dienstag, den 15. August bei Kirsten Buttgereit. Denn aufgrund der Urlaubszeit kann diese Sie bis 17. August beraten, ab 22.8. ist Herr Wörmann ihr Ansprechpartner. Durch Ihre rechtzeitige Interessenbekundungkann eine saubere Übergabe sichergestellt werden.
Weitere Besonderheit der Innovationssprints
Eine weitere Besonderheit neben der (anfangs) unkomplizierten Antragsstellung am Format Innovationssprints ist, dass bei Erfolg die beantragten Mittel relativ unkompliziert umgeschichtet werden können. In der Förderlinie heißt es hierzu: „Überschreitungen der Einzelansätze des Finanzierungsplans [sind] zulässig, sofern sie durch Einsparungen in anderen Einzelansätzen vollständig ausgeglichen werden.“ Außerdem besteht der Zwischennachweis nur aus einem zahlenmäßigen Nachweis.
Wer wird gefördert? Wer ist antragsberechtigt? Was wird gefördert?
Als InnovationsSprints gefördert werden anwendungsorientierte Forschungs- und Transferprojekte als Einzelprojekt an HAW, Universitäten oder außeruniversitären Forschungseinrichtungen oder als Verbundprojekt mit jeweils maximal einer Partnerin bzw. einem Partner aus der Wissenschaft und dem nichtwissenschaftlichen Bereich, z. B. einem Unternehmen, einem Verein oder einer Gebietskörperschaft (vgl. S. 4). Alle Partner können eine Förderung bis zu 150.000 Euro beantragen.
Demzufolge sind antragsberechtigt HAW, Universitäten und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen. Im Verbund sind zudem die Partner aus dem nichtwissenschaftlichen Bereich antragsberechtigt, dazu zählen zum Beispiel:
- Unternehmen
- Gemeinnützige Organisationen
- Gebietskörperschaften (Kommunen, Landkreise)
- Stiftungen, Vereine, Verbände
- Bildungseinrichtungen
Die Förderung ist offen für alle Themen und fachlichen Schwerpunkte. Adressiert werden explizit alle Innovationsarten, wie zum Beispiel technologische Innovationen, neue Geschäftsmodelle und Soziale Innovationen. Unter Sozialen Innovationen werden neue soziale Praktiken oder Organisationsmodelle verstanden, die technologieinduziert oder unabhängig davon sein können.
Anhang: Übergeordnete Ziele der Förderung
Mit der DATI sollen langfristig neue Wege der Förderung beschritten werden. Diese soll innovative Lösungen für gesellschaftliche oder wirtschaftliche Herausforderungen in einem Themenfeld oder einer Region unterstützen. Hierbei kommt den wissenschaftlichen Einrichtungen eine zentrale Rolle zu, sie sollen/können „Impulsgeber für den Austausch und die Ko-Kreation von Wissen und Technologien mit Anwendungspartnern aus der Praxis, kurzum „Transfer“ sein. Dieser forschungsbasierte Transfer trägt maßgeblich dazu bei, dass Innovationen entwickelt und umgesetzt werden.“
Beim Formulieren einer Kurzskizze ist es sicher hilfreich, die übergeordneten Ziele der DATIpilot-Förderung im Kopf zu haben:
- Ergebnisse und Kompetenzen der wissenschaftlichen Forschung für die Entwicklung von technologischen wie Sozialen Innovationen zu nutzen,
- wissenschaftliche Forschungsergebnisse für eine zukünftige innovative Anwendung zu qualifizieren,
- neue Anwendungsmöglichkeiten für wissenschaftliche Forschungsergebnisse zu erschließen,
- erfolgreiche Transfer- und/oder Innovationsaktivitäten zu skalieren,
- neue Formate für effektiven Austausch, Ko-Kreation und Kooperation in Partnerschaften zwischen Wissenschaft und Praxis zu erproben,
- potentielle Anwendungspartnerinnen und -partner aus Wirtschaft, Gesellschaft oder Verwaltung für eine Beteiligung an Forschungs- und Innovationsprozessen zu gewinnen,
- nachhaltige Partnerschaften zwischen Wissenschaft, Wirtschaft, Gesellschaft und Verwaltung zu stärken,
- Voraussetzungen, z. B. in Bezug auf rechtliche Rahmenbedingungen, für eine erfolgreiche Überführung von Forschungsergebnissen in eine Anwendung zu klären.
